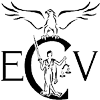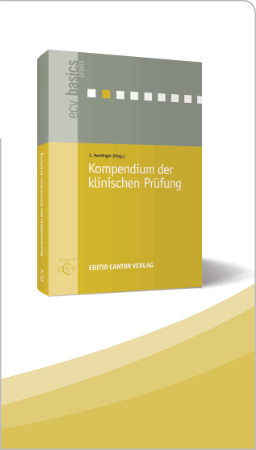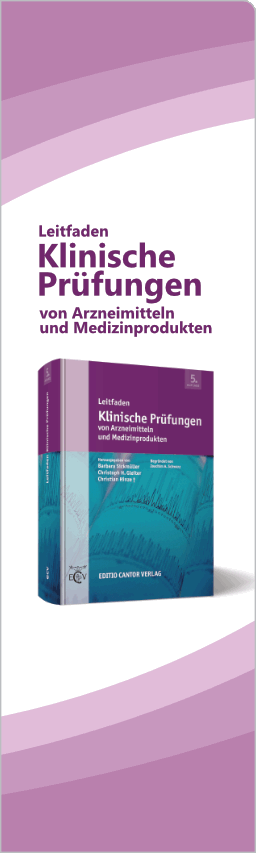Ihr Suchergebnis
Sie recherchieren derzeit unangemeldet.Melden Sie sich an (Login) um den vollen Funktionsumfang der Datenbank nutzen zu können.
In der Rubrik Zeitschriften haben wir 11911 Beiträge für Sie gefunden
-

Arzneimittelinnovationen und Positivliste
Rubrik: Gesundheitswesen
(Treffer aus pharmind, Nr. 07, Seite 581 (1999))
Arzneimittelinnovationen und Positivliste / Kaesbach W
Arzneimittelinnovationen und Positivliste Wolfgang Kaesbach, Bundesverband der Betriebskrankenkassen, Essen In den meisten Ländern der europäischen Union schließen sich ein wenige tausend Präparate umfassendes Arzneimittelangebot und dieses weiter einschränkende Erstattungslisten für das nationale Gesundheitssystem nicht aus. Etwaige dagegen gerichtete Protestaktionen von Gesundheitsberufen und Medizinindustrie gewinnen allenfalls lokale Bekanntheit. Bei knapp 45 000 verkehrsfähigen Arzneimitteln in Deutschland, davon über die Hälfte bis heute nicht einmal auf Wirksamkeit geprüft, ist die Einführung einer Positivliste längst überfällig. Es verwundert die Krankenkassen nicht, daß wie vor jeder Reform gleichsam ritualisiert das übliche Horrorszenario an die Wand gemalt wird: der Mittelstand ist existenzgefährdet, Arbeitsplätze gehen verloren, die Therapiefreiheit wird eingeschränkt, Versicherte werden vom therapeutischen Fortschritt abgekoppelt, und es droht schlechthin die Zwei-Klassen-Medizin. Die für Leistungserbringer willkommenste Problemlösung, nämlich mehr Geld ins System, hat sich die Regierungskoalition nicht zu eigen gemacht. Sie ist angetreten mit dem Ziel, anstelle der im Medizinbetrieb weit verbreiteten Beliebigkeit endlich Qualität einzufordern und die gesetzliche Krankenversicherung über den Verzicht auf unnötige und unzweckmäßige Leistungen zu rationalisieren. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Der Patient als neue Zielgruppe des Pharma-Marketing / Teil 1
Rubrik: Gesundheitswesen
(Treffer aus pharmind, Nr. 07, Seite 584 (1999))
Der Patient als neue Zielgruppe des Pharma-Marketing / Teil 1 / DaCruz P
Der Patient als neue Zielgruppe des Pharma-Marketing Teil 1 Patrick Da-Cruz und Dr. Michael C. Müller, Roland Berger & Partner GmbH, International Management Consultants, München Die auf den Patienten ausgerichtete Arzneimittelwerbung unterliegt weitreichenden gesetzlichen Restriktionen. Trotz dieser Restriktionen nimmt der Patient auch im Markt für ethische Arzneimittel eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die daraus resultierende Veränderung der anzusprechenden Zielgruppen erfordert von Pharmaunternehmen eine Anpassung des bislang hauptsächlich am Verschreiber ausgerichteten Marketing-Instrumentariums, wobei sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten anbieten: Die Anpassung bestehender Instrumente an die Zielgruppe Patient sowie der verstärkte Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Nutzung dieser Technologien im Rahmen integrierter Marketing-Konzepte, die sowohl Verschreiber als auch Patienten einbinden, bietet für das Pharmaunternehmen völlig neue Möglichkeiten der Kundensprache. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Rechtliche und praktische Aspekte externer Qualitätsprüfung / Möglichkeiten und Grenzen einer Vergabe im Lohnauftrag
Rubrik: Fachthemen
(Treffer aus pharmind, Nr. 07, Seite 593 (1999))
Rechtliche und praktische Aspekte externer Qualitätsprüfung / Möglichkeiten und Grenzen einer Vergabe im Lohnauftrag / Beckmann G
Dr. Dietrich Müller-Römer Rechtliche und praktische Aspekte externer Qualitätsprüfung Möglichkeiten und Grenzen einer Vergabe im Lohnauftrag RA Dr. jur. Dietrich Müller-Römer, Kanzlei Wirtz & Kraneis, Köln, und Dr. vet. med. Gero Beckmann, Labor L + S AG, Gesellschaft für Mikrobiologie und biologische Qualitätsprüfung, Bad Bocklet Das ökonomisch sinnvolle Outsourcing von Untersuchungen zur pharmazeutischen Qualitätskontrolle stößt auf die in § 14 Abs. 4 AMG gemachte Einschränkung: Die Prüfung der Arzneimittel kann teilweise außerhalb der Betriebsstätte in beauftragten Betrieben durchgeführt werden, wenn bei diesen geeignete Räume und Einrichtungen hierfür vorhanden sind. Aus juristischer Sicht ist der entscheidende Gesichtspunkt für die Grenzziehung zulässiger externer Prüfungen von Arzneimitteln die Verbesserung der Arzneimittelsicherheit durch die Erzielung einer höheren Prüfqualität in spezialisierten Einrichtungen, die sowohl apparativ als auch personell dem durchschnittlichen pharmazeutischen Herstellbetrieb überlegen sind. Aus seiner Stellung im Arzneimittelrecht sowie teleologischen Erwägungen ist der unbestimmte Rechtsbegriff teilweise dahin zu vestehen, daß Arzneimittelhersteller alle diejenigen Prüfungen, die über die Basis-Analytik hinausgehen, in gemäß § 12 PharmBetrV ordnungsgemäß beauftragten Laboratorien durchführen lassen können. Anhand der verschärften Anforderungen an Räume, Einrichtungen, Betrieb, Durchführung und Monitoring bei der Arzneibuch-konformen Prüfung auf Sterilität kann beispielhaft aufgezeigt werden, daß sich diese Prüfung für eine Lohnbeauftragung anbietet. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Selbstinspektion - Auditierung - Audit-Tourismus / Ein Diskussionsbeitrag zur Bewertung von Ziel, Zweck und Wirtschaftlichkeit von Inspektionen und Inspektionsgemeinschaften
Rubrik: GMP / GLP / GCP
(Treffer aus pharmind, Nr. 07, Seite 598 (1999))
Selbstinspektion - Auditierung - Audit-Tourismus / Ein Diskussionsbeitrag zur Bewertung von Ziel, Zweck und Wirtschaftlichkeit von Inspektionen und Inspektionsgemeinschaften / Prinz H
Selbstinspektion - Auditierung - Audit-Tourismus Ein Diskussionsbeitrag zur Bewertung von Ziel, Zweck und Wirtschaftlichkeit von Inspektionen und Inspektionsgemeinschaften Dr. Heinrich Prinz, Leiter Zentrale Qualitätssicherung der Biotest AG, Dreieich Selbstinspektionen sind im pharmazeutischen Unternehmen eine gesetzliche Verpflichtung. Dies bedeutet, daß laufend interne Abläufe in Abteilungen oder Bereichen auf Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben durch kompetentes, firmeneigenes Personal oder durch eine unabhängige Person überprüft werden müssen. Hierbei wird zum einen auf die ausreichende Umsetzung der notwendigen Regelungen interner als auch externer Art geachtet, zum anderen auf die Beachtung und strikte Umsetzung der Vorgabedokumente (SOPs) auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Eindeutigkeit und Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen. Um die Qualität der von externen Lieferanten und Unterauftragnehmern erbrachten Leistungen und Lieferungen zu belegen, wird immer mehr gefordert, daß auch eine Auditierung dieser Unternehmen nach Vertragsabschluß regelmäßig durch den Auftraggeber durchgeführt werden soll. Grundsätzlich ist eine Überprüfung (Auditierung) der Lieferanten und Unterauftragnehmer zu begrüßen, wenn konkrete Anlässe es notwendig machen oder sie Zulieferer qualitätsrelevanter Produkte und Arbeiten sind. Mittlerweile hat aber das externe Auditing Züge angenommen, die sehr oft mehr hinderlich als hilfreich sind und weit über das angestrebte Ziel hinausschießen. Es soll diskutiert werden, inwieweit laufende Lieferanten-Audits nach Vertragsabschluß sowohl für den Auditierten als auch für den Auditor bzw. seinem Auftraggeber wirklichen Nutzen bringen. Es wird diskutiert, ob es angebracht ist und welchen Vorteil es bringt, Audits für verschiedene Unternehmen zusammenzufassen und durch einen Unternehmensmitarbeiter oder durch externe, unabhängige Stellen (Consultants) durchführen zu lassen. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Fragen zur Kennzeichnung sowie zur Gebrauchs- und Fachinformation von Arzneimitteln
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 07, Seite 616 (1999))
Fragen zur Kennzeichnung sowie zur Gebrauchs- und Fachinformation von Arzneimitteln / Peter F
Fragen zur Kennzeichnung sowie zur Gebrauchs- und Fachinformation von Arzneimitteln RAe. Dr. Axel Sander und Felix Ludwig Peter, Geschäftsbereich Recht im Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V., Frankfurt/Main Die Kennzeichnung sowie die Gebrauchs- und Fachinformation von Arzneimitteln sind wiederholt Gegenstand gesetzlicher Änderungen gewesen. Die Verwaltungspraxis bei der Ausführung dieser Änderungen führte dabei immer wieder zu kontroversen Diskussionen, weshalb die Verfasser im folgenden drei unterschiedliche Fragestellungen aus dem Bereich der Kennzeichnung, der Gebrauchs- und Fachinformation aufgreifen wollen. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Zur innerstaatlichen Rechtsverbindlichkeit von Richtlinien des Rates und von EU-Empfehlungen
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 08, Seite 695 (1999))
Zur innerstaatlichen Rechtsverbindlichkeit von Richtlinien des Rates und von EU-Empfehlungen / Peter F
Zur innerstaatlichen Rechtsverbindlichkeit von Richtlinien des Rates und von EU-Empfehlungen Unter besonderer Berücksichtigung der Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal products for human use RAe. Dr. Axel Sander und Felix Ludwig Peter, Geschäftsbereich Recht im Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V., Frankfurt/Main Empfehlungen sind nach Art. 249 der konsolidierten Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften (im folgenden Vertrag von Amsterdam genannt), der vormals Art. 189 Abs. 5 EGV war, unverbindlich. Auch wenn Art. 249 des Vertrags von Amsterdam damit eine unmißverständliche Regelung getroffen hat, hat sowohl die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) als auch die Praxis der Europäischen Kommission bzw. der nationalen deutschen Behörden immer wieder die Frage aufgeworfen, ob nicht auch Empfehlungen eine rechtliche Relevanz zukommen kann. Aus diesem Grunde wollen die Verfasser im folgenden auf die Frage der Rechtsverbindlichkeit von Empfehlungen im nationalen innerstaatlichen Bereich näher eingehen. Daneben behandeln die Verfasser auch die Frage der innerstaatlichen Rechtsverbindlichkeit von Richtlinien des Rates. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Rechtsprechung - Schadenersatz für Festbeträge
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 08, Seite 704 (1999))
Rechtsprechung - Schadenersatz für Festbeträge /
Schadensersatz für Festbeträge (Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 27. Juli 1999, Az.: U (Kart) 33/98) Ausgewählt von RA Dr. Axel Sander Die Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind verurteilt worden, - es gegenüber der klagenden Pharmafirma zu unterlassen, die seit dem 1. Mai 1997 vorgenommenen Anpassungen der Festbeträge der Erstattungspraxis für bestimmte Fertigarzneimittel der Firma zugrunde zu legen oder zugrunde legen zu lassen, - gegenüber den ihnen angeschlossenen Krankenkassen zu erklären, daß diese Festbetragsanpassungen auf die genannten Arzneimittel der Firma nicht angewendet werden dürfen sowie - der Firma allen Schaden zu ersetzen, der ihr ab dem 1. Mai 1997 durch die Anpassung der Festbeträge für die genannten Arzneimittel entstanden ist. Ausschlaggebend für das Urteil war - die Einordnung der Krankenkassen als Unternehmen und der Spitzenverbände als Unternehmensvereinigungen i. S. d. Art. 81 Abs. 1 EGV, weil ihnen bei der Festbetragsfestsetzung ein erheblicher Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, - die Feststellung, daß zu den zu beachtenden gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften bei der Ausübung der den Mitgliedstaaten zustehenden Befugnisse zur Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme auch die Wettbewerbsregeln der Art. 81 u. 82 EGV gehören, - daß von der Festbetragsregelung als mittelbarer Festsetzung der Ankaufspreise ein starker preisregulierender Einfluß ausgeht, - daß die für Deutschland geltenden Festbeträge auch Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel haben können und - die Annahme eines jedenfalls in Form leichter Fahrlässigkeit vorliegenden Verschuldens der Spitzenverbände, weil sie die verfassungsrechtlichen Bedenken des Bundessozialgerichts nicht beachtet haben, die sich aus dem Vorlagebeschluß vom 14. 6. 1995 (Az.: 3 RK 20/94) ergeben. Das mit der Revision anfechtbare Urteil hat folgenden Wortlaut (Auszug): © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999 -

Gatekeeping - Herausforderung für den Bereich der niedergelassenen Ärzte
Rubrik: Gesundheitswesen
(Treffer aus pharmind, Nr. 09, Seite 769 (1999))
Gatekeeping - Herausforderung für den Bereich der niedergelassenen Ärzte / Berger D
Gatekeeping - Herausforderung für den Bereich der niedergelassenen Ärzte Daniel Berger, Direktor der Swiss Re Life & Health, Zürich (Schweiz), Dr. Ekhard Popp, A.T. Kearney GmbH, Düsseldorf, und Dr. Nikolaus Schumacher, A.T. Kearney, München Der Gesundheitsmarkt ist im Umbruch. Es scheint, als rolle eine Netzgründungswelle über den niedergelassenen Bereich. Fast im ganzen Bundesgebiet gibt es inzwischen niedergelassene Ärzte, die sich in Ärztenetzen organisiert haben. Und nahezu wöchentlich werden neue ,Netzinitiativen gegründet. Bundesweit können inzwischen mehr als 300 Praxisnetze und Netzinitiativen gezählt werden, die sich allerdings in ihrer Zielsetzung stark unterscheiden. Aufgrund der mit dem Vorschaltgesetz eingeführten Budgetierung ist der Handlungsspielraum der Krankenkassen begrenzt, was eine Förderung oder finanzielle Unterstützung der Netzinitiativen anbelangt. Daher wenden sich viele Netze an die pharmazeutische Industrie in der Hoffnung, beim Aufbau ihrer neuen Versorgungsstrukturen unterstützt zu werden. Die ärztlichen Ansätze zur Neuorganisation der ärztlichen Versorgung fällt in eine Zeit, in der die Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer mit der angekündigten Gesundheitsreform 2000 die medizinische Versorgung neu gestalten möchte. Im Gespräch ist u. a. eine Primärarzt-/Hausarztversorgung nach dem Schweizer Vorbild. Für die Patienten ergäbe sich daraus eine Wahlalternative zur Regelversorgung. Die niedergelassenen Ärzte müßten sich an neue Honorierungsformen wie Bonussysteme oder kombinierte Budgets gewöhnen. Gleichzeitig müßten sich die anderen Leistungserbringer, wie Krankenhäuser und Hilfsmittelhersteller, auf neue Formen des Wettbewerbs einstellen. Im folgenden Artikel wird dargestellt, worauf die Primärarztversorgung abzielt und welche Herausforderungen sich für den niedergelassenen Arzt ergeben. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Gibt es in Deutschland zu viele Arzneimittel? / Teil I: Parallelimportierte Arzneimittel
Rubrik: Arzneimittelwesen
(Treffer aus pharmind, Nr. 09, Seite 774 (1999))
Gibt es in Deutschland zu viele Arzneimittel? / Teil I: Parallelimportierte Arzneimittel / Fox J
Gibt es in Deutschland zu viele Arzneimittel? Teil I: Parallelimportierte Arzneimittel Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Johannes M. Fox, Universität des Saarlandes, Fachbereich Theoretische Medizin, und Merz + Co., Frankfurt/Main Bei der Beantwortung der Frage, ob es in Deutschland zu viele Arzneimittel gibt, d. h., daß das Angebot für die Ärzte unüberschaubar sei, kann an den parallelimportierten Arzneimitteln nicht vorbeigegangen werden, denn obwohl umsatzmäßig von untergeordneter Bedeutung repräsentieren sie zahlenmäßig immerhin 13,4 % der 1998 in Deutschland verkauften Arzneimittel. In der gesundheitspolitischen Diskussion werden die parallelimportierten Arzneimittel immer wieder als eines der wirksamen Preissteuerungsinstrumente im Rahmen der Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherungen ins Spiel gebracht. Es lohnt sich daher, den Markt der Parallelimporte näher zu betrachten. Dabei wird offenkundig, daß Parallelimporte als ein Preissteuerungsinstrument im Arzneimittelmarkt ungeeignet sind. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-

Handhabung elektronischer Dokumente und digitaler Signaturen nach den FDA-Richtlinien (Electronic Data, E-Signature) / Teil 1
Rubrik: Fachthemen
(Treffer aus pharmind, Nr. 09, Seite 784 (1999))
Handhabung elektronischer Dokumente und digitaler Signaturen nach den FDA-Richtlinien (Electronic Data, E-Signature) / Teil 1 / Gierend M
Handhabung elektronischer Dokumente und digitaler Signaturen nach den FDA-Richtlinien (Electronic Data, E-Signature) Teil 1 Arbeitsgruppe in der Deutschen Gesellschaft für Gute Forschungspraxis (DGGF): Sicherheit der Elektronischen Datenübermittlung in klinischen Prüfungen Dr. Reinhard Kobelt (Vors., Electronic Monitoring GmbH, Neuss), Dr. Michael Gierend (medicomp, Planegg), Dr. Peter M. Kaiser (PMK Pharma Consulting, Hameln), Dr. Hans-Jürgen Reiermann (Data TRAK, Bonn) und Dr. Raphael Teichmann (monipol, Bonn) Das Zeitalter des remote data entry unter Nutzung des Internet ist angebrochen: mehr und mehr Firmen und/oder CROs nutzen das vorhandene Netz und die - etwa bei Prüfärzten - installierten PC mit Internet-Zugang, um Daten, seien sie aus klinischen Prüfungen oder seien es Sicherheitsdaten über Medikamente (Spontanmeldungssystem), auf elektronischem Wege aus aller Welt kommend in eine zentrale Datenbank senden zu lassen, von wo sie dann in der Biometrieabteilung oder der Abteilung Drug Safety weiterverarbeitet werden können. Einige wenige Veröffentlichungen gibt es hierzu bereits [1, 2]; auch Anwendungsbeobachtungen sind bereits mit Hilfe dieser Technik durchgeführt worden [3]. So rasant sich dies alles entwickelt, so problematisch ist allerdings auch die Frage, ob der Datentransfer auf elektronischem Wege nicht nur validiert ist, sondern auch sicher. Mit dieser Frage beschäftigte sich die Arbeitsgruppe in der DGGF. Das Ergebnis der Arbeit wird hier in einem ersten Teil dargestellt. Ein zweiter Teil soll folgen, der mehr die Aspekte des Datenschutzes behandelt. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
Sie sehen Artikel 81 bis 90 von insgesamt 11911